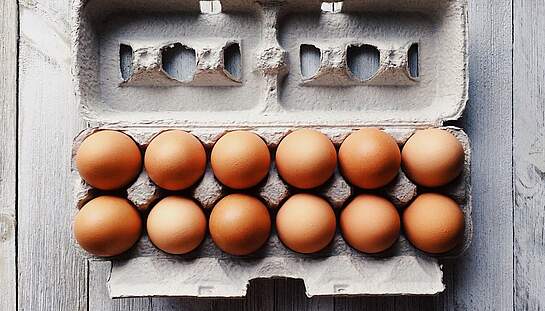Der Anteil der Ernährung an den durchschnittlichen Treibhausgasemissionen eines Deutschen beträgt laut CO2-Rechner des Umweltbundesamtes rund 15 Prozent. Dies verdeutlicht, dass der Beitrag der Ernährung zum Klimaschutz nur begrenzt ist und die deutlich größere Stellschraube im Bereich Energie – Heizen, Strom, Mobilität – liegt.
Eine wichtige Vergleichsgröße, um die Klimabilanz eines Produktes zu illustrieren, ist der sogenannte Carbon Footprint, zu Deutsch: Klimafußabdruck. Er gibt Auskunft darüber, wie viele Treibhausgasemissionen im gesamten Lebenszyklus eines Produkts oder einer Dienstleistung anfallen. Tierische Lebensmittel wie Wurst, Fleisch, Käse und Milchprodukte kommen bei solchen Berechnungen regelmäßig schlechter weg als pflanzliche. Allerdings vernachlässigt diese Betrachtungsweise, dass tierische Produkte zum Teil ganz andere ernährungsphysiologische Vorzüge haben, als pflanzliche Lebensmittel, sodass ein Vergleich hierzu immer hinkt.

Zwei entscheidende Faktoren sind bei Footprint-Betrachtungen auch die Grenze des betrachteten Systems und die Zuordnung von beispielsweise Umwelteffekten: Betrachtet man die Kuh isoliert, so steht diese aufgrund des Methanausstoßes aus der Verdauung in der Klimabilanz ziemlich schlecht dar. Betrachtet man jedoch das System „Kuh-Grünland“ und bezieht den CO2-Speicher im Grünland – das erst durch Wiederkäuer sinnvoll für die menschliche Ernährung genutzt werden kann – ein, so verbessert sich die Bilanz von Rindfleisch und Milchprodukten schlagartig. Die Kuh ist aufgrund der Grünlandnutzung nicht der Klimakiller, als der sie oft dargestellt wird. Das liegt daran, dass Umwelteffekte mal nach dem wirtschaftlichen Wert eines Produktes, oder seinem Volumen oder dem Gewicht berechnet werden, auch wenn das besagte Produkt aus demselben Produktionsprozess stammt (im Fall der Kuh Milch, Rindfleisch und Leder). Der so ermittelte Footprint ist also am Ende nicht besonders aussagekräftig.
Hinzu kommt, dass derart ermittelte standardisierte Footprint-Werte, sei es für Treibhausgasemissionen oder Wassereinsatz, nie die einzelbetriebliche Erzeugung abbilden und so nicht nur Unterschiede zwischen landwirtschaftlichen Betrieben verwischen, sondern auch innerhalb einzelner Lebensmittelgruppen. In manchen Fällen, kann es effizienter und besser sein, Lebensmittel regional und saisonal zu produzieren und in anderen können Handel, Lagerung und globale Arbeitsteilung besser für die Umwelt sein. Was für Kaffee, Kakao und Südfrüchte gilt, gilt genauso für Getreide, Milch oder Schweinefleisch: Eine möglichst effiziente und ressourcenschonende Produktion der benötigten Lebensmittel trägt mehr zum Klima- und Umweltschutz bei als einseitiger Verzicht (vgl. www.uba.co2-rechner.de/de_DE).
Was für die Berechnung von Klima-Footprints von Lebensmitteln gilt, ist prinzipiell auch für Wasser-Footprints anwendbar. Beim Wasser-Footprint kommt hinzu, dass der Begriff „Wasserverbrauch“ suggeriert, das Wasser werde für die Lebensmittelproduktion verbraucht und sei dann weg. Dies ist jedoch für natürlich vorkommendes Wasser nicht der Fall, da das Wasser in der Landwirtschaft im Kreislauf gehalten und wieder in die Natur zurückgebracht wird. Es ist unerheblich, ob Regen auf einer Waldfläche versickert und durch die Pflanzen verdunstet, oder ob dies auf einem Getreidefeld oder Stück Weide passiert.
Da Deutschland prinzipiell zu den landwirtschaftlichen Gunstregionen mit normalerweise ausreichend Niederschlägen und natürlichen Wasservorkommen gehört, führt deshalb eine Auflistung der im Laufe eines Wachstumszyklus benötigten Menge Wasser in die Irre. Einen entscheidenden Unterschied gibt es jedoch, wenn für Lebensmittel Wasserressourcen aufgrund mangelnder natürlicher Vorkommen nicht nachhaltig genutzt werden. Wenn beispielsweis in trockenen Regionen Grundwasserspeicher durch Bewässerung entleert werden oder Süßwasser teuer aus Meerwasser gewonnen werden muss, so ist dies nicht im Sinne einer nachhaltigen Ressourcennutzung.